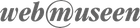19.2.2022

Ausstellung 27.02. bis 30.10.22
Die letzten Wikinger
…fahren in der Hochseefischerei
Windstärke 10
tägl. 10-18 Uhr
Di-So 10-17 Uhr
„Die letzten Wikinger fahren in der Hochseefischerei”: mit dieser Werbung lockte der Verband der Hochseefischer in den 1960er Jahren zahlreiche junge Männer als Arbeitskräfte an Bord der Fangschiffe. Hochseefischerei stand damals wie heute für harte Arbeit in den rauen Gewässern des Nordatlantik, aber auch für die Möglichkeit, schnell gutes Geld zu verdienen.
Die deutsche Hochseefischerei befand sich Anfang der 1960er Jahre in einer tiefgreifenden Umbruchphase. Die sich immer mehr bemerkbar machende Überfischung zwang zu einer deutlichen Ausweitung der Fanggebiete. Ein neuer leistungsstärkerer Schiffstyp machte dies möglich: der Heckfänger. 1960 wurde mit dem FMS Hessen auch in Cuxhaven das erste Fangschiff dieser neuen Generation in Dienst gestellt.
Schnell entwickelten sich die Heckfänger zu schwimmenden Fabriken. Auf einem eigenen Deck wurde der Fang maschinell filetiert und anschließend in Blöcken tiefgefroren. Erstmalig in der deutschen Hochseefischerei war nun auch personell die Arbeit an Deck von der Verarbeitung des Fisches getrennt. Hatten die Crews auf den alten Fischdampfern meist aus 23 Seeleuten bestanden, so vergrößerte sich die Besatzung der Fangfabrikschiffe nun auf bis zu 75 Mann. Unter ihnen waren auch zahlreiche Portugiesen, die als erfahrene Seeleute und Fischwerker geschätzt wurden.
Wer sich dafür entschied, auf einem der neuen Fangschiffe anzuheuern, der musste dem Leben an Land für bis zu drei Monate Lebewohl sagen. Wochenenden gab es an Bord nicht, gearbeitet wurde in einem Schichtsystem rund um die Uhr. Freizeit war knapp, der Rhythmus von Fang und Verarbeitung ließ gerade genug Zeit für Mahlzeiten und Schlaf.
Die deutlich effektiveren Fangtechniken der modernen Trawler führten dazu, dass die ohnehin unter Druck stehenden Fischbestände noch schneller dezimiert wurden. Die Küstenländer reagierten mit einer deutlichen Ausweitung ihrer nationalen Fangzonen. Vorreiter war dabei Island, das 1958 sein territoriales Seegebiet auf 12 Seemeilen ausdehnte und damit den ersten „Kabeljaukrieg” auslöste.
Die Auswirkungen für die deutsche Hochseefischerei waren dramatisch: ein großer Teil der angestammten Fangplätze durfte nun nicht mehr befischt werden, für die verbliebenen Gebiete bestanden strenge Regeln zur Schonung der Fischbestände. Nur über internationale Abkommen mit verschiedenen Küstenstaaten konnte die deutsche Hochseefischerei überhaupt aufrechterhalten werden.
Mit anschaulichen Inszenierungen, authentischen Exponaten und zahlreichen Fotos wird dieser wichtige Abschnitt der Cuxhavener Geschichte nun wieder lebendig.

Ausstellungsort
Maritimes Museum Windstärke 10
Herausforderungen und Gefahren der Seefahrt.

Schiff, Cuxhaven
Mueumsschiff „Elbe 1”

Museum, Cuxhaven
Joachim-Ringelnatz-Museum
Joachim Ringelnatz (1883-1934, eigentlich Hans Gustav Bötticher) war ein deutscher Schriftsteller, Kabarettist und auch Maler.

Schloss, Cuxhaven
Schloss Ritzebüttel

Museum, Cuxhaven
Schneidemühler Heimatstuben

Museum, Wurster Nordseeküste
Aeronauticum
Geschichte und Technik der Luftschiffe, Geschichte des Luftschiffplatzes Nordholz. Auf dem Freigelände Originalflugzeuge und -hubschrauber, die nach 1945 bei beiden deutschen Marinen im Einsatz gewesen sind.
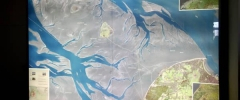
Zentrum, Cuxhaven
Nationalparkzentrum Wattenmeer

Bis 12.8.2024, Balje
Glanzlichter 2024

Bis 3.11.2024, Balje