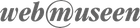17.4.2022

© Erich Heckel Nachlass
Ausstellung 17.07. bis 19.10.22
Erich Heckel
Aquarelle und Zeichnungen aus sechs Jahrzehnten
Kunsthaus der Apolda Avantgarde
Di-So+Ft 10-18 Uhr
In Zusammenarbeit mit dem Erich Heckel-Nachlass aus Hemmenhofen werden ca. 90 Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphiken aus allen Werkphasen des künstlerischen Schaffens Erich Heckels gezeigt. Im Zentrum der Ausstellung stehen als Sujets die Natur, der Mensch in der Natur und die Landschaft.
Als die Dresdner Architekturstudenten Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel am 7. Juni 1905 die Künstlergruppe „Brücke” gründeten, hatten sie vor allem ein Ziel vor Augen: sie wollten aufbrechen zu neuen Ufern der Kunst. Es galt, sich von der als starr empfundenen akademischen Malerei ihrer Zeit abzugrenzen. Auf der Suche nach dem Ursprünglichen zog es sie hinaus in die Landschaft.
Die symbiotische Beziehung der Künstler zur Natur blieb allen Mitgliedern auch nach Auflösung der Gruppe im Jahr 1913 ein Lebensprinzip. Nach dem Ersten Weltkrieg unternahm Erich Heckel ausgedehnte Reisen durch Europa. Das Landschaftsaquarell wurde in dieser Zeit zum bevorzugten Thema. Auch Blumenstillleben mit komplexen Bildhintergründen gehörten zu seinen präferierten Motiven.
Ab 1937 wurde Heckel von den Nationalsozialisten als „entarteter Künstler” verunglimpft. Über 700 seiner Werke hat das NS-Regime aus deutschen Sammlungen entfernt, beschlagnahmt, verkauft und verbrannt. Weitere Werke fielen einem Bombenangriff zum Opfer, darunter viele Frühwerke.
Nach Jahren der Verfolgung und der Zerstörung seiner künstlerischen Arbeit suchte Erich Heckel einen abgeschiedenen Ort zum Leben und Arbeiten. Diesen fand er in Hemmenhofen am Bodensee. Heckel und seine Frau Siddi verließen kaum noch ihre neue Heimat. Die letzten 15 Jahre seines Lebens verbrachte er zurückgezogen in Hemmenhofen, wo er vielfach geehrt, 1970 im 87. Lebensjahr starb.
Angesichts der harten Schicksalsschläge, die Erich Heckel und sein künstlerisches Werk immer wieder trafen, erscheint es uns fast wie ein Wunder, dass wir heute die Bilder jener „jungen Künstlergeneration” betrachten dürfen, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufbrachen, um sich „Arm- und Lebensfreiheit“ zu erkämpfen.

Ausstellungsort
Kunsthaus der Apolda Avantgarde

Museum, Apolda
GlockenStadtmuseum
Das Glockengießer-Handwerk, Kulturgeschichte der Glocke. Entwicklung des örtlichen Wirker- und Strickergewerbes.

Museum, Oßmannstedt
Wielandgut Oßmannstedt
Barockes Herrenhaus. Wohnsitz des Dichters Christoph Martin Wieland. Leben und Schaffen, Grabstätte im Park.

Burg, Kapellendorf
Wasserburg Kapellendorf
Burgen und Adel, Stadt und Bürgertum, Kirche und Klerus. Mittelalterliches Handwerk zum Anfassen und Selbermachen.

Museum, Jena
Phyletisches Museum

Bot. Garten, Jena
Botanischer Garten

Museum, Weimar
Schloss und Park Tiefurt
Sommersitz von Herzogin Anna Amalia, Stätte literarisch-geselliger Begegnungen für Goethe, Wieland, Herder, Schiller und die Brüder Humboldt. Goethe-Zimmer. Porzellan, Fayencen, Denkmäler (im Park).