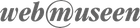1.6.2017

Foto: FSMT







Museum
Fränkische-Schweiz-Museum
im Judenhof
DE-91278 Pottenstein
info@fsmt.de
tägl. 10-17 Uhr
So 13.30-17 Uhr
Das Museum im restaurierten Fachwerkkomplex „Judenhof” befaßt sich mit allen Aspekten des faszinierenden Landschaftsraums Fränkische Schweiz und entwirft ohne falsche Romantik ein Bild vergangener Zeiten.
Die umfangreiche Sammlung bietet Einblicke in die Geologie, Archäologie und in die geschichtliche Entwicklung der Region und vermittelt lebendige Eindrücke von bäuerlichem Wohnen und Arbeiten, Handwerk und Zunftwesen.
Eine original erhaltene Synagoge aus dem 18. Jahrhundert sowie Zeugnisse evangelischer und katholischer Volksfrömmigkeit spiegeln die tiefverwurzelte Religiosität der Region wider.
Führungen, Konzerte, Vorträge, Sonderausstellungen und saisonale Veranstaltungen runden die breite Palette ab.

Erdgeschichte
Der Rundgang beginnt mit der Erdgeschichte. In dieser geologischen Abteilung sind Fossilien von Meeresbewohnern wie Ammoniten, Belemniten, aber auch seltene Versteinerungen von Fischen sowie ein sehr gut erhaltenes Krokodil zu sehen. Ein besonderes Ausstellungsstück ist das Skelett eines kleinen Krokodils, eines von weltweit drei Exemplaren dieser Art, in dessen versteinertem Magen sich Kieselsteine nachweisen lassen.
Archäologie
Mit ihren vielen Höhlen und Felsvorsprüngen bot die Region zahlreiche Aufenthaltsplätze für Jäger und Sammler an. Funde von Steinwerkzeugen aus dem Hasenloch bei Pottenstein gehören zu den ältesten menschlichen Zeugnissen.
Auch in den späteren Metallzeiten, wie Kupferzeit, Bronzezeit und Eisenzeit lebten in der heutigen Fränkischen Schweiz Menschen. In der Sammlung befinden sich zudem Teile des größten bayerischen Fundkomplexes aus der Völkerwanderungszeit.
Mittelalter
Die Fränkische Schweiz hat die höchste Dichte an Burgen Deutschlands. Schriftliche Zeugnisse und Fundobjekte zeugen vom zähen Ringen ums Dasein nicht nur während der Zeit der Bauernkriege und des Dreißigjährigen Krieges.
Eine großformatige Landkarte schildert detailgetreu den Einfall preußischer Truppen während des Siebenjährigen Krieges im Jahr 1759.
Landwirtschaft
Die steinigen und trockenen Felder auf der Albhochfläche erbrachten den Bauern nur einen geringen Ertrag. Dennoch war die Landwirtschaft über die Jahrhunderte der Haupterwerbszweig der Menschen in der Fränkischen Schweiz. Die ausgestellten bäuerlichen Werkzeuge und Gerätschaften wie Pflug, Sense und Egge und andere lassen erahnen, welche Mühen Frauen, Kinder und Männer aufwenden mussten.
Die Dörfer der Fränkischen Schweiz waren durch unbefestigte Wege miteinander verbunden, Bauern transportierten ihre Waren mit Leiterwagen und Karren von den Feldern zum Hof und dann weiter zu dem Märkten. Als Zugtiere dienten Kühe und Ochsen und nur selten auch Pferde.
Handwerk
Das Handwerk, zumeist im Nebenerwerb ausgeübt, ist seit jeher ein wichtiger Erwerbszweig in der Fränkischen Schweiz. Im Museum sind mehrere komplette Werkstatteinrichtungen ausgestellt. So lässt sich z. B. die Vielzahl von Werkzeugen bestaunen, die nötig waren, um ein Fass zu produzieren oder auch einen Schuh.
In der Schmiede findet sich überraschenderweise ein Apothekenschrank: dem Schmied kam auf den Dörfern die Funktion des Tierarztes zu. Zuweilen behandelte er auch menschliche Leiden („Roßkur”). In der Region sind zudem mehr als 100 Zünfte nachweisbar. Deren unverzichtbare Zunfttruhe war quasi das mobile Büro der Vereinigung.
Wohnen
Im 19. Jahrhundert lebten die Bauernfamilien in sehr beengten Wohnverhältnissen. Zwar wurde nicht mehr wie früher über dem offenen Feuer gekocht, aber Qualm und Ruß waren dennoch gang und gäbe – nicht nur in der Küche, sondern auch in den Wohnräumen.
Die Betten standen in ungeheizten und gedämmten Räumen meist im Obergeschoss, oftmals direkt unter den nackten Dachziegeln, Kinder mußten sich zuweilen ein Bett teilen. An den Abenden traf sich die Nachbarschaft, um gemeinsam Flachs zu verarbeiten, Wolle zu spinnen, Körbe zu flechten und vieles mehr.
Leben und Sterben
Die meisten Kinder gingen vom 6. bis zum 12. Lebensjahr in die Elementarschule. Nachmittags und in den Ferien halfen sie in der Landwirtschaft, hüteten Gänse oder paßten auf jüngere Geschwister auf. Kleidungsstücke wurden dabei meist so lange aufgetragen wurden, bis nichts mehr von ihnen übrig war.
Trachten zeigen die Identifikation der Menschen mit der Heimat. In der Fränkischen Schweiz bildete sich darin auch der jeweilige Wohlstand ab. Zur Hochzeitstracht einer Großbäuerin gehörte die Brautkrone: filigran aus dünnem Bronzedraht und Glasperlen gefertigt und mit zahlreichen symbolträchtigen Ornamenten ausgeschmückt, galt sie als Symbol für die weibliche Jungfräulichkeit und Ehrenhaftigkeit.
Volksfrömmigkeit
In katholischen Orten schlägt sich die Religiosität sichtbar in den vielen Geländedenkmälern wie Kapellen, Wegkreuzen und Bildstöcken nieder, steinerne Marter markieren die alten Wege und Pfade der Wallfahrer. Im Museum befindet sich aus der Zeit des Barocks eine außergewöhnliche Darstellung der Dreifaltigkeit: Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist sind als drei gleichartige und gleichwertige Figuren dargestellt.

Das Fatschenkind des Museums, eine reich geschmückte Jesuspuppe mit wächsernem Kopf und Glasaugen, war offenbar längere Zeit auf einem Dachboden Schmutz und Schadinsekten ausgesetzt und samt Schaukasten arg ramponiert, kam aber durch geduldiges Reinigen und Restaurieren zu neuem Glanz.
Synagoge
In den Gebäuden des heutigen Museums lebten mehrere jüdische Familien. Die Tüchersfelder Juden verkauften ihre Waren, oftmals Stoffe, als wandernde Händler an die Bevölkerung und sicherten so ihren kargen Lebensunterhalt. Die Synagoge bildete bis zum Erlöschen der örtlichen jüdischen Gemeinde das Zentrum des Gemeinlebens.

Kunst
Grafiken und Gemälden aus dem 19. Jahrhundert eröffnen dem modernen Betrachter unbekannte Ansichten. Denn die Vegetation auf diesen Bildern unterscheidet sich zur Gänze vom heutigen Istzustand: damals dominierten die kahlen, felsigen Hänge mit den Trockenrasenflächen, denen die Region ihren Namen „Fränkische Schweiz” verdankt.
Der Verfasser hat das Museum am 1.7.2020 besucht.

Gebäude, Pottenstein
Museum Burg Pottenstein
30jähriger Krieg. König Karl XII von Schweden, Zehntwesen, Graf von Pottenstein, Elisabeth von Thüringen.

Burg, Ahorntal
Burg Rabenstein
Barocke Schloßanlage über dem Ahorn- und dem Ailsbachtal, mit heute vielseitiger Nutzung, etwa die Jagd mit Greifvögeln oder das Keltendorf mit großem Feuerplatz.

Museum, Pottenstein
Scharfrichtermuseum
Sinn und Unsinn der weltweit nach wie vor verbreiteten Folter und Todesstrafe. Instrumente und deren Anwendung, Geschichten und Schicksale.

Zoo, Ahorntal
Falknerei Burg Rabenstein
Malerisch reizvoll gelegene Burg. Heimische Greifvögel und Eulen.

Museum, Gößweinstein
Wallfahrtsmuseum Gößweinstein
„Wallfahren und Pilgern“ in den großen Weltreligionen, Gnadenbildwallfahrt nach Gößweinstein. „Wachsmenschen“. Entstehungsgeschichte der Basilika. Außenstellen: Einsiedelei St. Moritz bei Leutenbach, Marienwallfahrtsstätte am Lohranger bei Pinzberg.

Museum, Ahorntal
Sophienhöhle
Eine der schönsten Schauhöhlen Deutschlands.

Museum, Wiesenttal
Modelleisenbahnmuseum
Museum im Privathaus der Familie Häntzschel. Modelleisenbahnen unterschiedlicher Spurweiten von Firmen aus dem Nürnberger Raum. Originalteile aus dem Bahnbetrieb, Dokumente, Plakate und historische Fachbücher.

Gehege, Egloffstein
Wildpark Hundshaupten
Der - leider nicht sonderlich pressefreundliche - Wildpark erstreckt sich auf einem 40 Hektar großen Gelände an den Hängen des Hüllergrabens. Gezeigt werden Großtiere wie Wisente und Elche, aber auch Luchse und Wölfe sowie alte Haustierrassen.

Museumsbahn, Ebermannstadt
DFS Dampfbahn Fränkische Schweiz
Alte Bahnstrecke zwischen Ebermannstadt und Behringersmühle. Historische Lokomotiven (auch Dampfloks) und Waggons. [Hinweis: detaillierter Fahrplan auf der Website.]

Bergwerk, Egloffstein
Felsenkeller Egloffstein
Gewaltige Kellergänge, die rund 700 Meter in das Innere des Berges führen.