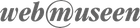29.3.2024
(modifiziert)


Museum
Lobdengau-Museum
der Stadt Ladenburg
Mi, Sa-So 14-17 Uhr
geschlossen
Das Museum befindet sich im Bischofshof und sieht sich als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Auf vier Ebenen lässt sich hier die Geschichte des Lobdengaus erschließen und erleben: Archäologie, mittelalterliche und neuzeitliche Stadtgeschichte sowie Volkskultur. Den Schwerpunkt bildet die reiche Römersammlung mit archäologischen Funde aus der römischen Hauptstadt LOPODUNUM im Untergeschoss des Museums.
Sol-Mithras-Relief
Während die Opferung des Stiers üblicherweise Schwerpunkt in der Darstellung war, haben sich auf dem Ladenburger Sol-Mithras-Relief die beiden Götter zum Opfermahl eingefunden. In einer Grotte sitzen auf der Stierhaut der Helios-Sohn und sein Bruder Mithras. Seit der Reform des Kultes ca. 630 v. Chr. durch Zarathustra verkörpern die Opfergaben, Gebäck und Trauben, das Blut und das Fleisch des Gottes und stehen als Zeichen für die Auferstehung der Gläubigen. In Rom konnte der Mithras-Kult ca. 90 n. Chr. nachgewiesen werden, ca. 30 Jahre später hatte sich der Kult bis nach Lopodunum verbreitet.
Prunkportal
Beim römischen Prunkportal von Ladenburg handelt es sich um einen der bedeutendsten Hortfunde aus römischer Zeit in Deutschland. Der Bronzeschatz wurde 1973 bei Bauarbeiten zum Gymnasium entdeckt. Die kunstvoll ausgearbeiteten Teile stammen aus der Mitte des 2. Jahrhunderts und wurden in Gallien hergestellt, vermutlich waren sie an einer Tempeltür angebracht: es ist die aufwändigste Türdekoration, die aus der Zeit vor der Völkerwanderung bekannt und im Original erhalten ist.
Von der Vorzeit zu den Kelten
Der etwa 100.000 Jahre alte steinzeitliche Schabekeil wurde benutzt, um Fleischreste vom Fell eines erlegten Wildes abzuschaben und damit für das Gerben vorzubereiten.
Die Vitrine zur Bandkeramik zeigt neben auswechselbaren Pflugscharen auch Töpferware mit dem auffälligen Bandmuster, nach dem die gesamte Epoche benannt wurde.
Aus der jüngeren Urnenfelderzeit wiederum stammt das gezeigte Vollgriffschwert. Es gibt nur drei solche Schwerter in deutschen Museen.
Die Viereckschanze auf Ladenburger Gebiet zeugt von der Größe der Siedlung. Lanzenspitze und Schildbuckel, Mühlstein und Töpferware, aber auch Schlacke aus den Rennfeueröfen zur Eisengewinnung sind interessante Hinterlassenschaften des keltischen Stammes der Helveter.
Mittelalter
Kurz nachdem Merian im Jahr 1620/21 seinen Stich von Ladenburg skizziert hatte, wurde die Stadt schwer von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges getroffen.
Das sogenannte „Lutz-Zimmer” mit großbürgerlichen Möbelstücken, darunter eine Kommode, die Kurfürst Carl IV Theodor seinem Schwetzinger Gartenarchitekten Nicolas de Pigage schenkte, kam als testamentarische Stiftung ins Museum.
Ofenkacheln und Kleinodien sowie Funde aus dem Grab des Bischofs „Ludwig-Anton von Pfalz Neuburg”, gefunden bei Renovierungsarbeiten in der St.-Sebastianskapelle, erinnern an die Bischofszeit.
Volkskunst
Im Museum befindet sich die originale Statue des Stadtpatrons Sankt Antonius (des Großen), die dem Kurpfälzer Hofbildhauer Paul Egell zugeschrieben wird.
Die Bauernmalersippe Baier aus dem Odenwald war vor allem durch ihre „Vogelschränke” bekannt. Die Sammlung des Lobdengau-Museums, zusammengetragen durch Dr. Heukemes, ist vermutlich die größte von Baier-Schränken in Deutschland.
Blick über Ladenburg
Im begehbaren Erker des Museums steht ein Ledersofa, von wo die Besucher abschließend in aller Ruhe den schönsten Blick über die Türme Ladenburgs genießen können.

Museum, Ladenburg
Automuseum Dr. Carl Benz
Ehemalige Wirkungsstätte von Carl Benz (1844-1929), ein lichtdurchfluteter Industriebau des Mannheimer Architekten Josef Battenstein.

Bis 30.6.2024, Heidelberg
Kunst und Fälschung
Erstmalig bringen das Kurpfälzische Museum und das Institut für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg eine Vielzahl beschlagnahmter Fälschungen zur Ausstellung.

Museum, Ladenburg
Karl-Benz-Haus
Hier lebte Karl Benz bis zu seinem Tod am 4. April 1929, seine Frau Bertha Benz bis zu ihrem Tod am 5. Mai 1944.

Museum, Mannheim
TECHNOSEUM
200 Jahre Industrialisierungsgeschichte, Inszenierungen zur Technik- und Sozialgeschichte, interaktive Experimentierfelder zu Naturwissenschaften und Technik.
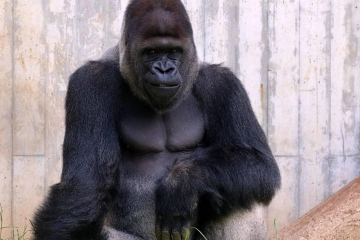
Zoo, Heidelberg
Zoo Heidelberg
Affenhaus, Robben- und Raubtierrevier, Elefanten und Vögel. Ausstellungen zu Naturschutzthemen und Tieren in der Kunst, Energielehrpfad, Artenschutzprojekt für westafrikanische Affen in Ghana. Bauernhofrevier.

Museum, Heidelberg
Kurpfälzisches Museum
Archäologie, Stadtgeschichte, Kunsthandwerk, Gemälde und Grafik.

Museum, Mannheim
Städtische Kunsthalle Mannheim
Überregional bekannte Sammlungen der Malerei und Plastik des 19. und 20. Jahrhunderts, Graphisches Kabinett. Impressionismus, Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Informel. Beckmann, Dix, Kandinsky, Klee, Liebermann, Cézanne. Internationale Skulptur.