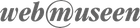31.3.2017


Das Bild zeigt das Amberger Rathaus und die Maria-Hilf-Berg Kirche.






Museum
Stadtmuseum Amberg
DE-92224 Amberg
stadtmuseum@amberg.de
Di-Fr 11-16 Uhr
Sa-So 11-17 Uhr
Die geschichtlichen Wurzeln Ambergs reichen mehr als 1000 Jahre zurück: 1034 wurde die Stadt als „Ammenberg” erstmals urkundlich erwähnt. Wahrscheinlich hat es aber bereits im 8. oder 9. Jahrhundert eine erste Ansiedlung an diesem Ort gegeben. Die eingangs aufgestellte Turmuhr von St. Martin (um 1620) und die Stadtwaage im Rathaus (dat. 1785) haben den Bewohnern der Stadt über mehrere Jahrhunderte „Maß und Zeit” vorgegeben.
Die Amberger Hochzeit
Pfalzgraf Philipp feierte im Februar 1474 in Amberg die Vermählung mit der 18-jährigen Margarete, der Tochter Herzog Ludwigs IX. des Reichen von Bayern-Landshut. Es war das größte mittelalterliche Fest in Amberg. Die Turniere waren dabei genauso wichtig wie die Bankette und Tanzvergnügen.
Weitere Themen des Museums sind die Stadtgeschichte, die Amberger Industrie, das Einkaufen zu Uromas Zeiten, wie Bier gebraut wurde und sich unsere Vorfahren kleideten.
Stadtgeschichte
Zwischen der Stadt und den Pfälzischen Kurfürsten gab es mehrfach scharfe Auseinandersetzungen. Beim Amberger Aufruhr von 1453/54 ging es um eine verweigerte Huldigung, und es rollten Köpfe. Das Amberger Lärmen 1592/97 wiederum galt vordergründig dem „rechten Glauben”, eigentlich aber den Machtansprüchen der Kurfürsten. Der Sieger der Schlacht am Weißen Berg 1620, Herzog Maximilian I. von Bayern, erhielt das Fürstentum der Oberen Pfalz als Kriegsentschädigung, und Amberg wurde wieder bayerisch, verlor aber den Rang einer Residenzstadt.
Im Mittelalter und der frühen Neuzeit waren Eisenverhüttung und der Handel mit Eisen Ambergs wichtigste Wirtschaftszweige, denn die Oberpfalz war in dieser Zeit das europäische Eisenzentrum, und die schiffbare Vils stellt die direkte Verbindung zum Fernhandel auf der Donau her.
Unter der Regierung von Max I. Joseph, ab 1806 König von Bayern und auf einem repräsentativen Porträt im Krönungsornat und mit der rechte Hand auf der Verfassungsurkunde dargestellt, wurde 1810 die Regierung der Oberpfalz von Amberg nach Regensburg verlegt.
Handwerk
Der Gemischtwarenladen der Geschwister Rom, die Bäckerei Singer aus der Löffelgasse sowie eine Wein- und Likörhandlung erinnern an das Geschäftsleben zu Omas Zeiten. Die Zahnarztpraxis von Martin Dorner in Vilseck stammt aus der Zeit um 1900-1920. In der Abteilung „Aspekte des Gesundheitswesens” ist die Ladeneinrichtung der alten Adler-Apotheke (1875-85) maßgetreu so aufgestellt wie sie den Amberger Kunden vertraut war.
Die Tradition des Bierbrauens reicht im Amberger Stadtgebiet bis in die Zeit der Franziskaner-Mönche im 15. Jahrhundert zurück. Gezeigt werden unter anderem zwei umfangreiche Privatsammlungen an Amberger Bierkrügen.

Die Abteilung „Kleider machen Leute” lädt zu einem Spaziergang durch 200 Jahre Kleidungsgeschichte von der Biedermeierzeit bis heute ein. Es wird gezeigt, wie sich die Menschen, vom Hilfsarbeiter bis zum hohen Beamten, gekleidet haben: zu festlichen Anlässen, an Sonn- und Feiertagen, im Alltag, bei Arbeit und Beruf, in der Freizeit und beim Sport, in guten und schlechten Zeiten. Und wo man sie gekauft hat. Die Beziehung der Geschlechter zueinander beruhte auf der ungebrochenen Vorherrschaft des Mannes. Die Kleidung der Frauen zielte darauf ab, „damenhaft” auszusehen, obwohl ein großer Teil von ihnen keineswegs ein damenhaftes Leben führen konnte. Das Korsett betonte zudem die Geschlechtsreize der Frau. Kinder aus gutem Hause zwängte man in enganliegende, steife und unbequeme Kleidung.

Trachtenkleidung wurde weniger in der Stadt, sondern vorwiegend im ländlichen Bereich getragen.
Das Thema „Heimisches Handwerk” findet in den nun folgenden Abschnitten seine schlüssige Fortsetzung: Friseur, Schuhmacher, metallverarbeitendes Handwerk und Goldschmied. Handwerker lassen sich in Amberg seit 1326 schriftlich nachweisen. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bestimmte die Zunft die Ausbildung. Sie lag voll in den Händen der Meister, da die Werkstatt der einzige Ausbildungsort war. Meister konnten aber nur wenige werden, viele bleiben ihr Leben lang Geselle.
Im 19. Jahrhundert vollzog sich mit der Industrialisierung ein Wandel der Arbeitsformen, und die Industriebetriebe verdrängten allmählich die alten Handwerke. Mit dem Armaturwerk Fortschau entstand die erste Waffenmanufaktur in Bayern. Auch die erste Dampfmaschine der Oberpfalz stellte man 1831 in Amberg auf.
Amberger Steingut
Die ältesten erhaltenen Waren der Steingutfabrik Amberg stammen aus der Zeit des frühen Biedermeier. Es haben sich Teller, Tassen, Kannen und Kummen erhalten. Den englischen Steingut-Vorbildern von Wedgwood, der sog. „cream-ware” nacheifernd, besaßen die Stücke einen cremefarbenen Scherben mit transparenter Glasur. Zwischen 1875 und 1930 gab es einen kaum überschaubaren Formenreichtum bei Emailwaren. Jede Speise, jede Zutat, jede Küchenarbeit gelangte zu eigenen Gerätschaften.
Münzschatzfunde
Am Mittag des 24. Februar 1992 entdecken Bauarbeiter beim Durchbruch eines Kellergewölbes im Haus Lederergasse 5 einen in die Wand eingemauerten Krug, der mit etwa 20 kg Silbermünzen gefüllt war. Die älteste Münze stammt aus dem Jahr 1694, die jüngste von 1812. Am Nachmittag des 8. September 1992 wurde ein weiterer Krug entdeckt. Der Fund besteht nur aus 20-Kreuzer-Stücken und einem einzigen 10-Kreuzer-Stück, die ihrem Erhaltungszustand nach relativ bald nach dem Prägen aus dem Umlauf genommen worden waren. Die Funde gewähren uns einen sehr guten Einblick in die Münzgeschichte dieser Zeit.
Zu allen Zeiten waren die weitaus häufigsten Ursachen für das Verbergen von Schätzen Kriegswirren. Als die Amberger Münzfunde versteckt werden (ab 1808 und ab 1812), bedrohte Napoleon Bonaparte mit seinen Kriegszügen ganz Europa.
Michael Mathias Prechtl
Besonderes Highlight ist die 2016 eröffnete Dauerausstellung „A Tribute to Michael Mathias Prechtl”, die das Werk des international bekannten Künstlers (1926-2003) präsentiert.
Prechtl erhielt seine Ausbildung zum Graphiker an der Kunstakademie Nürnberg. Das erlernte technische Können diente ihm als erste Erwerbsquelle. In den 1950er Jahren entstanden Gouachen, Aquarelle und wenige Ölbilder. Bevorzugte Modelle waren seine Frau und seine Tochter Pamela. Seine Farbigkeit ist kräftig und kontrastreich. Ab 1960 begann Prechtl sich intensiv mit dem Werk Albrecht Dürers zu befassen, seit 1963 war er zweiter Vorsitzender der AD-Gesellschaft. Er organisierte Ausstellungen, gestaltete 40 Kataloge, 17 Plakate und die Ausstellung zu Dürers 500. Geburtstag im Jahr 1971. 1970 reiste er „auf Dürers Spuren” mit einem Filmteam in die Niederlande.
Die Werkgruppe „Charakterbilder” besteht aus Bildnissen bedeutender Personen aus Kunst-, Literatur-, Musik- und Wissenschaftsgeschichte. Stets gab Prechtl, der ein extrem belesener Künstler war, mit eingearbeiteten Attributen im Kopf- oder Brustbereich Hinweise auf Tätigkeit, Geschichte, Verdienste und Charakter des Gezeichneten. Seine Plakate wiederum nannte er „öffentliche Bilder”: er machte keine Werbeplakate im üblichen Sinn, keine Produktwerbung, sondern ausschließlich Kunst- und Kulturplakate. Seine Auftraggeber waren Museen, Theater, Opernhäuser und Verlage.
Der Verfasser hat das Museum am 8.2.2013 und am 13.10.2023 besucht.

Bis 13.10.2024, im Haus
Mensch ärgere Dich nicht
1907 entwickelte der in Amberg geborene Josef Friedrich Schmidt in seiner winzigen Wohnung in München-Giesing das Spiel „Mensch ärgere Dich nicht”. Es wird zum beliebtesten Spiel der Deutschen: bis heute sind mehr als 90 Millionen Exemplare verkauft worden.

Im gleichen Haus
Stadtgalerie Alte Feuerwache
Jährlich etwa acht Wehselausstellungen Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst aus Ostbayern. Malerei, Grafik, Plastik, Objekt, Fotografie, Neue Medien und Installation.

Museum, Amberg
Luftmuseum
Im ersten und bisher weltweit einzigen Luftmuseum wird Luft sichtbar, hörbar, erlebbar und begreifbar.

Ausstellungshaus, Amberg
Amberger Congress Centrum

Museum, Kümmersbruck
Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern
Bergbau und Industrie des ostbayerischen Raumes in einem 1781 erbauten Hammerherrenschloß mit Herrenhaus und weitläufigem Wirtschaftstrakt. Außenanlagen: Eisenhammerwerk, Glasschleif- und Polierwerk, Mühle, Schachtanlage.

Museum, Amberg
Militärhistorische Sammlung
Uniformen, Ausrüstungsgegenstände, Karten, Waffen und Orden. Baugeschichte der Amberger Kasernen, Entwicklung von der Reichswehr über die Wehrmacht zur Bundeswehr.

Museum, Sulzbach-Rosenberg
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg
Bergbau, Keramik, Druckerei, Handwerk, Kirchengeschichte, Stadtgeschichte, Schloß und Fürstentum.

Museum, Freudenberg
Tempel Museum
Vorgeschichte und Realisierung des Gesamtkunstwerks Glyptothek in Etsdorf. Hintergründe, Themen und Bezüge zu 2.500 Jahren Demokratie und Bürgersinn.

Museum, Kastl
Heimatmuseum
Historisches Bauernhaus mit Scheune. Sammlung Franz und Anna Maria Weiß bäuerlichen und handwerklichen Kulturguts. Trachten, Uhren und Waagen, religiöse Volkskunst.

Museum, Sulzbach-Rosenberg
Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg
Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur, Korrespondenz der Literaturzeitschrift Akzente, Erstfassung der Blechtrommel von Günter Grass, regionale Literatur.

Museum, Sulzbach-Rosenberg
Rumburger Heimatsammlung
Objekte aus Rumburg (Rumburk) in Nordböhmen. Modell eines Webstuhls und die dazugehörigen Utensilien.