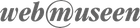Ausstellung 06.06. bis 24.09.23
Der kalte Blick
Letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnów
Naturhistorisches Museum
Mo, Do-Sa 9-18.30 Uhr
Mi 9-21 Uhr
Di geschlossen
Ende 1941 entwickelten zwei Wiener Wissenschaftlerinnen ein Projekt zur „Erforschung typischer Ostjuden”. Mit „kaltem Blick” fotografierten sie im März 1942 in der deutsch besetzten polnischen Stadt Tarnów mehr als hundert jüdische Familien, insgesamt 565 Männer, Frauen und Kinder. Von diesen überlebten nur 26 den Holocaust und konnten später davon berichten. Erhalten geblieben sind die Bilder und Kurzbiografien der Ermordeten.
Die sogenannte physische Anthropologie ist Teil der Forschung des Naturhistorischen Museums Wien. In der Anthropologischen Sammlung entdeckte Dr. Margit Berner, seit 1991 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin am NHM Wien, einen Karton, der die Fotos der nun bekannten jüdischen Familien enthielt.
Berner ist es zu verdanken, dass die Menschen von Tarnów und ihre Geschichte, ihre Familien und ihre Individualität ins Blickfeld geraten sind. In jahrelanger mühevoller Kleinarbeit machte sie einige Familien ausfindig. Für viele waren es die ersten Fotos ihrer Angehörigen, für einige die einzigen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind nicht nur in dieser Ausstellung, sondern auch in dem umfangreichen Buch „Letzte Bilder. Die rassenkundliche Untersuchung jüdischer Familien im Ghetto Tarnów 1942” veröffentlicht.
Die Ausstellung dokumentiert zum einen das ehrgeizige Vorgehen der beiden Wissenschaftlerinnen, zum anderen erzählt sie vom Leben der Juden in Tarnów vor 1939 und von deren Ermordung unter deutscher Herrschaft – exemplarisch für die Verfolgung und Vernichtung hunderter jüdischer Gemeinden in dem von Deutschen beherrschten und terrorisierten Polen.

Ausstellungsort
Naturhistorisches Museum
Prächtiger Palast der Naturwissenschaft und eines der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Museen der Welt. Berühmte und unersetzbare Exponate, etwa die 25.000 Jahre alte Venus von Willendorf, die vor über 200 Jahren ausgestorbene Stellersche Seekuh, riesige Saurierskelette und vieles mehr. Eines der 10 besten Museen der Welt.

Dependance, Wien
Pathologisch-anatomisches Museum
Bedeutendes Denkmal zur Geschichte der Krankenversorgung und der Medizin. Weltweit größte Sammlung pathologischer Präparate. Feucht- und Trockenpräparate, Moulagen und Geräte.

Museum, Wien
Kunsthistorisches Museum
Gemäldegalerie, Ägyptisch-Orientalische Slg., Antikensammlung, Kunstkammer, Münzkabinett. Eines der größten und bedeutendsten Museen der Welt. Objekte aus dem alten Ägypten, der Antike, dem Mittelalter und der Neuzeit bis etwa 1800.

Bis 9.9.2024, Wien
Über Tourismus
Tourismus hat Wertschöpfung, Wohlstand und Weltoffenheit auch in die entlegensten Gegenden gebracht. Dem gegenüber stehen negative Effekte: touristische Hotspots leiden unter dem Ansturm der Besucher.

Museum, Wien
Leopold Museum
Meisterwerke des Wiener Secessionismus, der Wiener Moderne und des österreichischen Expressionismus. Weltweit größte Egon-Schiele-Sammlung.

Bis 26.1.2025, Wien
Auf dem Rücken der Kamele
Der thematische Bogen in der Ausstellung spannt sich von den Urkamelen Nordamerikas über deren Domestikation und weltweite Verbreitung bis zur Haltung von Kameliden als nahezu universelle Nutztiere.