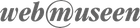5.1.2024
(modifiziert)

Foto: Rainer Göttlinger

© Bayerische Schlösserverwaltung

Foto: Studio Thomas Köhler © Bayerische Schlösserverwaltung
Schloss
Neues Schloss und Hofgarten
DE-95444 Bayreuth
sgvbayreuth@bsv.bayern.de
tägl. 9-18 Uhr
tägl. 10-16 Uhr
Das Schloß mit barockem Hofgarten, 1789 zum Landschaftsgarten umgestaltet, wurde durch Markgraf Friedrich v. Brandenburg-Bayreuth 1753 auf dem Gelände der ehemaligen Renn- und Reitbahn errichtet, wobei bereits bestehende Bauten in die von Joseph Saint-Pierre entworfene Architektur einbezogen wurden.
Die prunkvoll ausgestattete Räume umfassen vor allem das Spiegelscherbenkabinett, den Salon mit Golddecke, das Japanische Zimmer sowie das Alte Musikzimmer mit seinen Pastellbildnissen von Sängern, Schauspielern und Tänzern. Im südichen Flügel des Schlosses befindet sich das wohl bedeutendste Raumkunstwerk des Bayreuther Rokoko: auf die kostbare, stark gemaserte Nussholzvertäfelung des Palmenzimmers sind geschnitzte und vergoldete Palmbäume aufgelegt, die mit ihren Kronen bis den Himmel hineinzuragen scheinen. Das Spalierzimmer wiederum erweckt die Illusion eines offenen Gartenpavillons.
Nach Vollendung des Hauptschlosses ließ der Markgraf ab 1759 für seine zweite Gemahlin, Sophie Karoline von Braunschweig-Wolfenbüttel, das zunächst frei stehende „Italienische Schlösschen” errichten. Wenig später wurde dieses mit dem Südflügel des Neuen Schlosses verbunden.
Ausstellungen im Schloss
In den Räumen wird eine umfangreiche Sammlung Bayreuther Fayencen der 1716 gegründeten Manufaktur (Sammlung Rummel) gezeigt. Thema der Ausstellung ist „das Bayreuth der Markgräfin Wilhelmine”. Weiters befindet sich im Schloss eine Zweiggalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit Werken des Spätbarock sowie die reguläre „Miniaturensammlung Dr. Löer” mit galanten und erotischen Miniaturen des 18. Jahrhunderts.

Haupthaus, München
Bayerische Schlösserverwaltung
Eine der traditionsreichsten Verwaltungen des Freistaates Bayern und mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern, Hofgärten, Schlossparks, Gartenanlagen und Seen einer der größten staatlichen Museumsträger in Deutschland.

Im gleichen Haus
Das Bayreuth der Markgräfin Wilhelmine
Leben und Wirken der Wilhelmine von Bayreuth, Überblick über das Bayreuth ihrer Zeit.

Im gleichen Haus
Staatsgalerie im Neuen Schloß
Europäische Barockgalerie. Achtzig Werke der niederländischen und deutschen Malerei vom ausgehenden 17. bis in das 18. Jahrhundert.

Museum, Bayreuth
Archäologisches Museum
Funde der Altsteinzeit, des Mesolithikums und der Frühlaténezeit: jungsteinzeitliche Steinäxte, Tongefäße aus der Hallstattzeit, keltischer Bronzeschmuck. Rekonstruktionen von Webstuhl, Steinbohrer und Schiebemühle. Jagdzimmer mit naturalistischen Stukkaturen.

Museum, Bayreuth
Urwelt-Museum Oberfranken
Saurier der Trias in Oberfranken, Erdgeschichte, Mineralien, begehbares Goldkristallgitter, Bayreuth vor 200 Millionen Jahren. Drachenhöhle, Dinosauriergarten und Bärenhöhle. „Zeitmaschine” für spannende Reisen in die Erdgeschichte.

Gebäude, Bayreuth
Markgräfliches Opernhaus
Eines der schönsten Barocktheater Europas und seit 2012 UNESCO-Weltkulturerbe. Überwältigendes Raumerlebnis durch illusionistische Effekte. Fürstenloge.