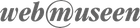20.7.2017








Museum
Rangau-Handwerkermuseum
DE-91459 Markt Erlbach
info@heimatverein-me.de
So+Ft 13-16 Uhr
Im ehemaligen Pfarrhaus, einem stattlichen Fachwerkgebäude mit freitragendem Dachstuhl aus dem 17. Jahrhundert, hat der Heimatverein Zeugnisse einer verschwundene Welt zusammengetragen: Werkstätten, die durch die Industrialisierung und die Umrüstung auf moderne Maschinenanlagen überflüssig wurden, die Ausstattung einer Arztpraxis, einen Krämerladen samt Warenangebot und vieles mehr. Dokumentiert sind auch die Geschichte des Ortes, die Herstellung von Blechblasinstrumenten, die Funde von Saurierfährten sowie die Verdienste überregional bekannter Bürger der mittelfränkischen Marktgemeinde.
Zentraler Ort im Rangau
Markt Erlbach wurde 1132 erstmals erwähnt und darf also zu den ältesten Siedlungen im Rangau gezählt werden. Am Kreuzungspunkt wichtiger Straßen gelegen, profitierten der Ort und seine ansässigen Wirte und Handwerksbetriebe von den Durchreisenden. 1528 führt Markgraf Georg der Fromme die Reformation ein. Hundert Jahre später verwüstete der Dreißigjährige Krieg den Ort. 1791 wurde Markt Erlbach preußisch, kam dann 1807 unter französische Besatzung und gehörte nur wenig später zu Bayern. Wirtschaftlichen Aufschwung und Fortschritt erfuhr der Ort durch den Bau der Eisenbahn 1902.
Der Boder
Im Mittelalter befeuerte der Betreiber einer Badstube – der Bader – nicht nur das zentrale Schwitzbad, sondern kümmerte sich auch um Körperpflege, Hygiene und medizinische Versorgung. Denn die Kirche untersagte 1163 im Konzil von Tours den meist theologisch vorgebildeten Ärzten den Kontakt mit Blut, so dass von da an der Bader zusätzlich zum Haarschnitt und Rasur auch die „kleine Chirurgie” ausführte: Wunden versorgen, Brüche richten, Zähne reißen, schröpfen oder Klistiere setzen. Er verkaufte und verabreichte auch selbst hergestellte Medizin und bot Künste wie „Aderlassen” oder „Schröpfen” an, um kranke Säfte aus dem Körper zu leiten.

Anfang des 20. Jahrhunderts lösten dann Ärzte, Zahnärzte, Friseure und Perückenmacher die Bader ab, die Ausbildung wurde eingestellt, und der Beruf starb aus. Im Volksmund aber blieb das fränkische „Boder" für den Friseur erhalten.
Das Spital
Vom Bezirksamt aufgefordert, ein Spital zu errichten, bestückte die Gemeinde eine kleine Wohnung mit einem einfach ausgestatteten Operationsraum, der ortsansässige praktische Arzt übernahm die Stelle des Krankenhausarztes und führte ab da auch Operationen durch, assistiert von einem Spital- oder Krankenwärter und später von einer ausgebildeten Krankenschwester. Für die Narkose waren ortsansässige Hebammen zuständig. In erster Linie versorgte man Knochenbrüche und entzündete Blinddärme, nahm aber auch Entbindungen vor.
Die Apotheke
Nur wer finanziell dazu in der Lage war, konnte sich seine Medikamente in der Apotheke kaufen, die Mehrzahl der ländlichen Bevölkerung behalf sich mit Hausmitteln, überlieferten Rezepturen und Heilkräutern. Für den Betrieb einer Apotheke brauchte es zudem eine behördliche Erlaubnis. Der Apotheker Friedrich Müller betrieb parallel eine Spezerei (Gewürzhandlung), einen Eisenhandel und eine Weinschänke und stellte Mineralwasser her.
Die Handwerkerstuben
Die wirtschaftliche Situation des Ortes war von alters her vom handwerklichen Mittelstand geprägt. Neben der kleinbäuerlichen Landwirtschaft versorgten zahlreiche Handwerker den Markt mit ihren Erzeugnissen und Leistungen: vom Hufschmied bis zum Schreiner, vom Bader bis zum Schneider, vom Metzger und Bäcker bis zur Näherin, vom Büttner bis zum Wagner, Schuster oder Uhrmacher war alles vertreten und in Zünften organisiert. Auch die Bierbrauer waren stark vertreten. Kutscher, Gemeinde- und Postboten, Gastwirte und Kellner sowie Tagelöhner komplettierten das Angebot.
Der Schmied stellte Gebrauchsgegenstände und Werkzeuge aus Eisen her und beschlug die Zugpferde im Ort. Vom 19. Jahrhundert an kam die Arbeit an Landmaschinen hinzu. Im Zentrum der Werkstatt standen der Amboss und die Esse, Hämmer, Zangen und Feilen hingen in Reichweite. Mit den Pferden verschwand auch der Schmied aus dem Dorfbild.
Das Schusterhandwerk zählt zu den ältesten Gewerken überhaupt: sie waren für die Herstellung lederner Schuhe, Sandalen und Stiefel zuständig. Die traditionellen Handwerkszeuge des Schneiders sind Nadel, Faden, Schere und Bügeleisen, Schneiderkreide, Maßband und Fingerhut. Im 19. Jahrhundert wurde die Nähmaschine erfunden und eingesetzt.
Der Uhrmacher konstruierte Uhren, er reparierte und wartete sie aber auch. Mit dem Aufkommen industriell hergestellter Billiguhren erlebte der Beruf einen erheblichen Rückgang.
Bis ins 20. Jahrhundert waren vom Büttner hergestellte Fässer aus Holz gängige Behältnisse: man lagerte und transportierte Wein und Bier, Sauerkraut, gepökeltes Fleisch oder Essig darin. Büttner fertigten aber auch Krüge und Eimer. Der Wagner wiederum baute Wagen, Karren und Schlitten, deren eiserne Teile vom örtlichen Grobschmied stammten. Vom Schreiner kamen Türen, Tische, Stühle, Schränke, Truhen, Vitrinen, Betten und Theken, aber auch Fensterläden und in ländlichen Gegenden sogar die Särge.
Zu den wichtigsten Handwerkern und Dienstleistern im Ort zählen die Bäcker – stellten sie doch das „,täglich Brot" für die Einwohner her. Die Verarbeitung von Schlachtvieh war Aufgabe der Metzger: auf dem Land war es üblich, sich den Metzger ins Haus zu holen. Das sorgfältig vorbereitete Schlachtfest war ein besonderer Tag!
Nahrungsmittel, die man nicht selber durch Hausschlachtung und Anbau im eigenen Garten ernten konnte, weil sie wie Kaffee, Kakao, Tee, Sago, Südfrüchte oder Gewürze aus den Kolonien kamen, kaufte man im Gemischtwarenladen, wo es auch Seife und Putzmittel, Haushalts-, Kurz- und Schreibwaren gab – und die neuesten Nachrichten. Es herrschte ein vertrautes Verhältnis, und wer kein Geld bei sich hatte, konnte anschreiben lassen.
Die jüdische Gemeinde
Jüdischen Mitbürgern war der Broterwerb durch Handel und Finanzgeschäfte erlaubt. Meist üben sie den Beruf des Vieh- oder Pferdehändlers, des Stoff- und Kurzwarenhändlers aus. Ab 1933 wurden auch die 12 in Markt Erlbach ansässigen Juden Opfer der nationalsozialistischen Vertreibung, für acht von ihnen haben sich die Unterlagen ihrer Ermordung erhalten.
Söhne Markt Erlbachs
Jakob Trapp, 1895 in Markt Erlbach geboren, erlernte schon früh am Nürnberger Konservatorium die Violine und studierte an der Akademie für Tonkunst in München Dirigieren und Komposition. Zusammen mit seiner Frau, der Sängerin Auguste Dietz, gründet Trapp 1927 in München eine private Musikschule, die sich Konservatorium nennen durfte. Seiner Heimat, die er im Lied „Meine Heimat ist Markt Erlbach im schönen Frankenland” verewigte, blieb er lebenslang sehr verbunden. Eugen Roth widmete ihm das Gedicht „Ein Mensch, obwohl die Zeit ihm knapp, wünscht dennoch Glück dem Jakob Trapp”.
Ignatz Schneider aus Bamberg übernahm 1860 die ansässige Apotheke und wurde so zu einem der Honoratioren der Gemeinde auf. 1888 wählen ihn die Markt Erlbacher zum ersten Vorsitzenden des Eisenbahnkomitees, er war fortan federführend am Bau der Eisenbahn nach Markt Erlbach beteiligt.
Johann Lorenz Kreul stieg in Nürnberg, wohin die Familie zog, zum begehrten Kunst-und Porträtmaler auf: seine Auftraggeber waren die Fürstenhöfe von Ansbach und Bayreuth. In München malte er Königin Therese, die Frau König Ludwigs I. von Bayern, Jean Baptiste Bernadotte, den späteren König von Schweden, Graf Hardenberg sowie den Schriftsteller Jean Paul. Trotzdem hielt er weiterhin auch Menschen aus seiner Heimatstadt in Pastell fest.

Georg Eberlein, geboren 1819 in Linden, machte sich vor allem um die Wiederentdeckung der schon bald zum nationalen deutschen Stil ausgerufenen Gotik verdient: er dekorierte die Burg der Hohenzollern, restaurierte den Erfurter Dom und die Aschaffenburger Stiftskirche und stattete Schloss Lichtenstein und die Veste Coburg aus. Seine Heimat hielt Eberlein in der Rangau-Mappe, einer Sammlung von 25 Aquarellen, fest.
Einen bedeutenden Geistlichen besaß die Pfarrei Markt Erlbach in Samuel Wilhelm Oetter. Sein Interesse galt der Geschichte, der Vor- und Frühgeschichte, der Denkmal- und Archivpflege, der Wappen-, Siegel- und Münzkunde sowie der Sprach- und Literaturgeschichte. 1774 grub er eine Reihe vorchristlicher Totenhügel aus.
Luthers Mitstreiter und Reformator Caspar Löner verfasste reformatorische Texte, einen Katechismus, über 40 Kirchenlieder sowie einen bedeutenden Beitrag zur Augsburger Konfession.
Exulanten aus Österreich
Als der Dreißigjährige Krieg 1648 mit dem westfälischen Frieden endete, siedelten sich etwa 70 aus Österreich vertriebene „Exulanten” in Markt Erlbach an. Der tolerante Markgraf von Brandenburg Ansbach gewährte ihnen Zuflucht zum eigenen Nutzen, denn die tüchtigen Handwerker und Bauern rekultivieren das Land und bauen die zerstörten Häuser wieder auf.
Abdrücke von Dinosauriern
1949 fand ein Bauer beim Pflügen seines Ackers auf Sandsteinplatten Spuren von Fährten landbewohnender Reptilien. Herr Wondra, ein Bürger Markt Erlbachs, und der ortsansässige Arzt Dr. Richard Metzner bargen diese Fährten und veranlassten wissenschaftliche Untersuchungen. In der Faunenkunde werden die beiden Arten seitdem als Chirotherium wondrai und Coelurosaurichnus metzneri Heller geführt. Die Tiefe der Abdrücke verrät das Gewicht der Tiere, ihre Geschwindigkeit ergibt sich aus der Stellung und den Abständen der Fußspuren. Abdrücke von nur den Hinterbeinen zeigen die Fähigkeit der Tiere, sich aufrecht auf zwei Beinen zu bewegen.
Der Verfasser hat das Museum am 5.6.2022 besucht.

Beitrag, 26.8.2021
Handwerksmuseum Markt Erlbach
Nach einem langwierigen Umbau mit grundlegender Gebäudesanierung wurde 2019 das „Museum Geschichte und Handwerk” in Markt Erlbach wieder eröffnet.

Bis 2.6.2024, Bad Windsheim
Evangelische Migrationsgeschichte(n)
Schwerpunkt der Ausstellung sind die Gruppen von Glaubensflüchtlingen, die im 17. Jahrhundert in Franken eine neue Heimat gefunden haben.

Museum, Emskirchen
Heimatmuseum
Altes Bauernhaus von 1632. Ortsgeschichte, bäuerliche Wohnkultur, örtliches Handwerk, Zahnarztpraxis aus den 1950er Jahren, Schusterei und Zitherwerkstatt.

Bis 30.4.2024, Nürnberg
Spielzeug und Rassismus
Kann Spielzeug rassistisch sein? Woran erkennt man Rassismus bei Spielsachen? Und wie begegnet man dieser Problematik im Alltag und im Museum?
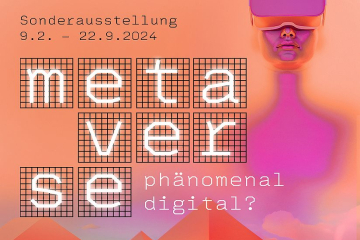
Bis 22.9.2024, Nürnberg
Metaverse: Phänomenal Digital?
Die Ausstellung zeigt soziale, wirtschaftliche und rechtliche Phänomene, wie wir sie heute schon in „prototypischen Metaversen” wie Decentraland, Second Life oder VR Chat vorfinden, und beleuchtet die positiven und negativen Entwicklungen.


Museum, Langenzenn
Fronveste
Ehemaliges Stadtgefängnis für leichtere Vergehen, heute Alte Apotheke mit historischer Einrichtung.

Bis 2.6.2024, Ansbach
Herrscher und Himmelsdeuter
Die Erkenntnis, dass um den Jupiter vier Monde kreisen, war revolutionär. Hofastronom Simon Marius entdeckte sie am 8.1.1610, einen Tag nach Galilei. Von ihm stammen jedoch die Namen der Monde: lo, Europa, Ganymed und Kallisto.

Museum, Langenzenn
Heimatmuseum
Geologie des Zenntals mit Saurierfährten, Vor- und Frühgeschichte, Langenzenner Pfennige von 1361 und 1425, Schusterwerkstatt, Blankwaffen, Trachten u.v.m.

Museum, Wilhelmsdorf
Zirkelmuseum
Reißzeugherstellung, Sammlung von Zirkeln und Reißzeugen.

Bis 1.9.2024, Nürnberg
Dürer under your skin: Tattoo art
Die präsentierte Auswahl zeigt die motivische Bandbreite der Tattoos, die sich überwiegend am druckgrafischen und zeichnerischen Werk Dürers orientieren.