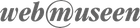26.1.2024
(modifiziert)

© Bayerische Schlösserverwaltung

© Bayerische Schlösserverwaltung

Foto: „Joe MiGo”
Burg
Willibaldsburg
mit Bastionsgarten
DE-85072 Eichstätt
sgvansbach@bsv.bayern.de
Di-So 9-18 Uhr
Di-So 10-16 Uhr
Die Burganlage auf dem Willibaldsberg wurde 1355 durch Bischof Berthold v. Hohenzollern gegründet und zwischen 1560 und 1590 unter Martin v. Schaumberg vergrößert. Den Umbau zur repräsentativen Residenz unter Fürstbischof Johann Conrad von Gemmingen (reg. 1595-1612) vollzog der Augsburger Baumeister Elias Holl. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die bischöfliche Hofhaltung in die neue Stadtresidenz verlegt, und im 19. Jahrhundert die Willibaldsburg schließlich als Steinbruch genutzt.
Heute beherrscht der Gemmingenbau das Erscheinungsbild. Die mächtige Zweiturmfassade hatte ursprünglich drei Stockwerke und Zwiebelhauben auf den Türmen.
Der „Bastionsgarten” und seine Pflanzenwelt stützt sich auf das 1613 erschienene Kupferstichwerk „Hortus Eystettensis” des Apothekers und Botanikers Basilius Besler (1561-1629), den dieser ab 1592 angelegt hatte. Der einst berühmte botanische Garten des Fürstbischofs von Gemmingen bildete eine Art „Kunstkammer im Freien” mit lebendigen Pflanzen aus aller Welt. Neben einigen schon länger bekannten Pflanzen aus Europa und dem Mittelmeerraum besaß der Eichstätter Fürstbischof auch etliche Raritäten aus dem erst einhundert Jahre zuvor entdeckten Amerika, wie die Sonnenblume, die Tomate, den Lebensbaum, die Agave oder die Kartoffel: Pflanzen, von denen heute kaum noch jemand weiß, woher sie ursprünglich kommen.
Das Florilegium
Und auch wenn der historische Garten schon Ende des 18. Jahrhunderts aufgehört hatte zu exisitieren, blieb doch die Kenntnis über die Pflanzenwelt dieses Gartens durch das berühmte Florilegium „Hortus Eystettensis” erhalten. Heute zeigt der Bastionsgarten in etwa die Hälfte der über 1000 im Kupferstichwerk gezeigten Pflanzen. Die Ausrichtung der Bepflanzung in den schmalen Schaubeeten – das erste Beet mit Frühlingsgewächsen und das letzte Beet mit winterblühenden Pflanzen – orientiert sich analog zum Pflanzenbuch an der Blütezeit der dort gezeigten Gewächse.

Haupthaus, München
Bayerische Schlösserverwaltung
Eine der traditionsreichsten Verwaltungen des Freistaates Bayern und mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern, Hofgärten, Schlossparks, Gartenanlagen und Seen einer der größten staatlichen Museumsträger in Deutschland.

Im gleichen Haus
Jura-Museum
Erdgeschichtliche Entwicklung der Südlichen Frankenalb. Fossilien der weltberühmten Solnhofener Plattenkalke: zarte Krebse und Insekten, riesige Fische, seltene Flugsaurier, der Raubdinosaurier „Juravenator starki” sowie der berühmte Urvogel Archaeopteryx.

Beitrag, 5.10.2020
Florale Paradiese auf Papier
Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg zeigt hochkarätige illustrierte Pflanzenbücher.
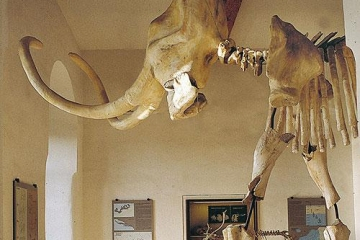
Museum, Eichstätt
Museum für Ur- und Frühgeschichte
Entwicklungsgeschichte der Region von der Steinzeit bis zum Frühmittelalter. Tierskelette von Mammut, Höhlenhyäne und Rentier. Epoche vom ersten Auftreten des Menschen im Eichstätter Raum bis zur Christianisierung. Römerfunde.

Museum, Eichstätt
Diözesanmuseum
Paramente des Mittelalters und des Barock, Malerei und Skulptur der Spätgotik, Goldschmiedekunst.

Zentrum, Eichstätt
Infozentrum Naturpark Altmühltal
Ehemalige Klosterkirche. Die Ausstellung verbindet klassische Elemente mit vielen Stationen zum Hören, Fühlen und Entdecken: Naturlandschaft, Kuppelfresko, Kultur des Naturparks. Biotopgarten und Garten der Sinne.