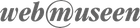12.3.2024
(modifiziert)








Museum
Museum Starnberger See
(ehemals Heimatmuseum)
DE-82319 Starnberg
info@museum-starnberger-see.de
Mi-Fr 14-18 Uhr
Sa-So+Ft 11-18 Uhr
Der Museumskomplex besteht aus dem Lochmann-Haus, einem denkmalgeschützten bäuerlichen Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, und dem 2008 eröffneten „Neuen Haus”. Die Dauerausstellung beschäftigt sich einerseits mit der ländlichen Lebens- und Arbeitswelt und andererseits mit der höfischen Schifffahrt der Wittelsbacher auf dem Starnberger See.
Die Anfänge des Lochmann-Hauses reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück, es steht noch immer am ursprünglichen Ort. Ungewöhnlich sind die zwei getrennten Wohnebenen: die obere Stube ist reich mit gotischer Vertäfelung geschmückt. Dort residierte die adelige Herrschaft. Im schlichten Erdgeschoss lebte eine Bauern- und Fischerfamilie, die das Anwesen bewirtschaftete.
Wandvertäfelung und Decke von ca. 1520 der oberen Stube wurden nachträglich in den 1691-1693 errichteten Wohnteil eingebaut. Das Holz für die dahinterliegenden Wände wurde im Frühjahr 1691 geschlagen, Vertäfelung und Decke stammen also vermutlich aus dem Vorgängerbau.
Die vom Flur abgeteilte Küche („Kuchl”) ist der zentrale Feuerungsplatz im Erdgeschoß: auf der gemauerten Feuerstelle wurde mit Dreifuß und Pfanne über offenem Feuer gekocht, von hier wurde der Stubenofen beheizt. Der älteste Balken des Hauses befindet sich im Stall und stammt von einem Baum, der im Winter 1474/75 gefällt wurde.
Das Lochmannhaus ist mehr als ein Bauwerk. In ihm drücken sich Lebensweisen und Machtverhältnisse vergangener Zeiten, aber auch Handlungen und Schicksale einzelner Personen aus. Die durchlebten Zeiten, die wechselnde Nutzung und Bedeutung haben sich in das Haus eingeschrieben und sind heute Gegenstand historischer Forschung.
1912 wurde das Lochmannhaus zum Museum. Der Wohnbereich blieb im Originalzustand erhalten, in den Wirtschaftsteil wurden Ausstellungsräume eingefügt. Die Tenne erhielt eine neue Funktion als Hauptsaal des Museums.
Die Ausstellung im Neuen Haus ist vor allem dem See und der Schifffahrt gewidmet.
Der Einbaum stammt wahrscheinlich von einem Werftgelände am Starnberger See und wurde schon 1926 in die Museumssammlung aufgenommen. Zahlreiche Gebrauchs- und Reparaturspuren deuten darauf hin, dass er viele Jahre intensiv genutzt wurde. Einbäume gehören zu den ältesten Bootstypen der Menschheit: im Starnberger See wurden mehr als zehn prähistorische Einbäume gefunden.
Das Ruderschiff „Delphin” wurde 1834/35 als neues Leibschiff für König Ludwig I. gebaut. Es besitzt ein Kabinett mit zwei Flügeltüren und versenkbaren Fenstern. Im Inneren befinden sich gepolsterte Bänke. Nach dem Tod seines Vaters 1864 erwarb König Ludwig Il. das Dampfschiff „Maximilian” als sein persönliches Eigentum, benannte es in „Tristan” um, und benutzte es vor allem für seine Fahrten vom Bahnhof Starnberg nach Berg und zur Roseninsel. Er unternahm aber auch gerne Ausflüge mit Gästen.
Neben diesen Originalen illustrieren zahlreiche Modelle die Schifffahrt auf dem See.
Das Dampfschiff „Ludwig”, ein 1871 bei Escher Wyss in Zürich für 300 Personen gebauter Raddampfer, war 36.60 Meter lang. 1919 erfolgte die Umbenennung des Schiffes in „Tutzing”, 1937 wurde es außer Dienst gestellt. Der Raddampfer „Bavaria” gebaut nach Plänen von Escher Wyss und 1878 in Dienst gestellt, konnte etwa 1000 Personen befördern und war 18-19 km/h schnell. Der Münchner Bildhauer Lorenz Gedon gestaltete das Schiff in den Formen der Renaissance. 1940 wurde die „Bavaria" verschrottet. Auch der Raddampfer „Wittelsbach”, 1886 von Maffei in München gebaut, war für 1000 Personen ausgelegt. Das Schiff wurde 1919 in „Starnberg” umgetauft und 1950 verschrottet.
Villenkultur und Tourismus
Die Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts besaßen kein besonderes Verhältnis zur freien Natur. Man liebte eher die extrem durchgestalteten barocken Gartenanlagen, in denen der Mensch der Natur seinen Willen aufzwang. Erst vor der Wende zum 19. Jahrhundert entdeckte man die unberührte Natur und sehnte sich nach einem vermeintlich unverfälschten und ungezwungenen Landleben.
Die Villenkolonie Niederpöcking, wie sie im Neubau im Modell gezeigt wird, wurde vom schwerreichen Münchner Kaufmanns Angelo Knorr gegründet. Die einheimische Bevölkerung sprach schon bald von „Protzenhausen” – vielleicht in Anspielung auf die vielen Kröten, im bayerischen Dialekt „Protzen”, die es am waldigen Ufer gab, vielleicht aber auch in Anspielung auf die „protzigen” Sommerresidenzen der Städter.
Johann Ulrich Himbsel (1787-1860) veränderte mit Einfallsreichtum und technischem Wissen die Strukturen Bayerns. Als Privatmann baute er 1851 das erste Dampfschiff auf dem Starnberger See und 1854 die Eisenbahn von Pasing nach Starnberg. Er legte damit den Grundstein für den Ausflugsverkehr an den Starnberger See. Der Erfolg war so überwältigend, dass Bahnlinie und Schifffahrt nur wenige Jahre später verstaatlicht wurden. Ein Modell zeigt den Bahnhof Starnberg, wie er um 1870/80 ausgesehen hat.
Höfischer Prunk auf dem Wasser
Die höfische Schifffahrt am Starnberger See und die großen Seefeste waren geprägt vom Bild des absolutistischen Herrschers.
Das mit Abstand feudalste Schiff auf dem damals noch Würmsee genannten See war das Prunkschiff „Bucentaur”, von dem im Museum ein sehr genaues Modell im Maßstab 1:20 ausgestellt ist. Es kam 1909 Leihgabe des Deutschen Museums nach Starnberg, der Modellbauer ist unbekannt. Bauweise und Gestaltung des „Bucentaur" sind sehr gut erkennbar: im Unterdeck saß die Rudermannschaft (64 Ruder), hier und am Bug waren auch die 16 Bordkanonen untergebracht. Das Mitteldeck und die umlaufende Galerie waren dem Hof und seinen Gästen vorbehalten. Die Fenster konnten bei Bedarf versenkt werden. In der Mitte des Vorplatzes am Bug befand sich ein Springbrunnen, der durch Pumpen im Unterdeck gespeist wurde. Auf dem Oberdeck verrichteten die Matrosen und die Musiker ihren Dienst. Man feierte festliche Bankette auf dem „Bucentaur” oder unternahm nächtliche Fahrten bei Illumination und Feuerwerk. Eine in ganz Europa berühmte Spezialität waren die Seejagden, bei denen ein Hirsch ins Wasser getrieben und vom „Bucentaur” aus erlegt wurde.
Schon Kurfürst Max Emanuel, der im „Sonnenkönig” Ludwig XIV. von Frankreich sein großes Vorbild sah, gestaltete das Münchner Hofleben prachtvoll und mit immensem finanziellem Aufwand. Und als er nach den Jahren des Exils (1704-1714) nach München zurückkehrte, wurden auch die Seefeste in Starnberg wieder mit allem Pomp gefeiert. Auftraggeber für das große Prunkschiff „Bucentaur” und die „Rote Halbe Galeere" – die beiden prächtigsten Schiffe, die je auf einem deutschen Binnengewässer fuhren – war Kurfürst Ferdinand Maria, dem 1662 nach zehnjähriger Ehe endlich der Thronfolger Max Emanuel geboren worden war.
Die prunkvoll gestalteten Schiffe des Münchner Hofes dienten als „schwimmende Staatskarossen” der gesteigerten Selbstdarstellung des Herrschers und der Repräsentation des Staates: wenn der führende Adel des Landes oder ausländische Gäste zu Besuch waren, wurden alle Register der Prachtentfaltung gezogen, denn das steigerte die Bedeutung und das politische Gewicht des Landes.
Der Verfasser hat das Museum am 4. Februar 2024 besucht.
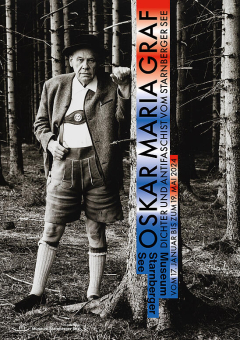

Schloss, Feldafing
Casino auf der Roseninsel
Die Roseninsel mit einer kleinen Inselvilla, dem sog. «Casino», und dem ebenfalls von Lenné gestalteten Rosengarten wurde zu einem der Lieblingsaufenthalte seines Sohnes Ludwig II., der dort ausgewählte Gäste empfing.

Museum, Pöcking
Kaiserin Elisabeth Museum
Kleines, einzigartiges Museum im Königssalon des historischen Bahnhofs Possenhofen am Starnberger See. Spannendes aus dem Leben der Kaiserin Elisabeth, auch Sisi genannt.

Bis 6.10.2024, München
Viktor&Rolf
Mit atemberaubender Virtuosität loten Viktor Horsting und Rolf Snoeren seit über 30 Jahren immer wieder die Grenzen zwischen Couture und Kunst aus. Viele Kreationen sind in dieser ersten großen Retrospektive zum ersten Mal ausgestellt.

Bis 22.9.2024, München
Liliane Lijn. Arise Alive
Lijns Werk zeigt eine Verbundenheit mit surrealistischen Ideen, antiken Mythologien und feministischem, wissenschaftlichem und sprachlichem Denken.

Bis 30.6.2024, München
Goldene Passion
Die Studioausstellung löst ein spannendes Rätsel im Werk des aus Weilheim stammenden Künstlers, der noch im 18. Jahrhundert als „deutscher Michelangelo” gerühmt wurde.

Museum, Bernried
Museum der Phantasie
Museumsgebäude für die Sammlungen des Malers, Photographen, Verlegers und Kunst- und Romanautors Lothar-Günther Buchheim am Ufer des Starnberger Sees. Expressionistensammlung von Gemälden und Graphiken der „Brücke”-Maler.

Bis 30.4.2024, München
Wildleben Afrikas
Der Liebhaber der tropischen und subtropischen Regionen Afrikas inszeniert in dieser Ausstellung eindrucksvoll berühmte Savannen-Protagonisten wie Löwe, Elefant und Zebra.

Bis 15.9.2024, Dachau