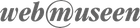16.4.2012

Foto: Röntgen-Kuratorium Würzburg e.V.

Foto: Röntgen-Kuratorium Würzburg e.V.


Museum
Röntgen-Gedächtnisstätte
DE-97070 Würzburg
sp@wilhelmconradroentgen.de
Mo-Fr 8-19 Uhr
Sa 8-17 Uhr
Die Röntgen-Gedächtnisstätte erinnert am Ort der Entdeckung der X-Strahlen an die Arbeit des Physikers Prof. Dr. Wilhelm Conrad Röntgen.

Hier im ehemaligen Physikalischen Institut der Universität Würzburg entdeckte Röntgen am späten Freitagabend des 8. November 1895 – seinen Worten zufolge „als sich keine dienstbaren Geister mehr im Hause befanden” – beim Experimentieren mit einer fast luftleeren Kathodenstrahlröhre jene sensationelle Strahlen, denen er den Namen X-Strahlen gab.
Seine Entdeckung revolutionierte unter anderem die medizinische Diagnostik und führte zu weiteren wichtigen Erkenntnissen des 20. Jahrhunderts. Damit seine Apparate schneller eingesetzt werden konnten, verzichtete er auf deren Patentierung.
Erster Physik-Nobelpreisträger
1901 erhielt Röntgen für seine Arbeit den ersten Nobelpreis für Physik.
Es war der berühmte Anatom Exzellenz Geheimrat von Koelliker, der vorschlug, die Strahlen nach ihrem Entdecker zu benennen: Röntgenstrahlen.
Neukonzeption 2020
Die zum 125. Jahrestag der Entdeckung neu gestaltete Röntgen-Gedächtnisstätte gewährt dem Besucher einen Einblick in die experimentelle Physik des ausgehenden 19. Jahrhunderts und zeigt neben der Entdeckungsapparatur einen Kathodenstrahlversuch – der Basis dieser Entdeckung war – ebenso wie einen Durchleuchtungsversuch mit X-Strahlen sowie den historischen Hörsaal Röntgens.
Über Röntgens Forschungstätigkeiten und die Technik des Röntgens hinaus läßt das moderne Ausstellungskonzept vor allem auch das Leben und die als introvertiert beschriebene Person Wilhelm Conrad Röntgen erfahrbar werden. Er starb 1923 im Alter von 77 Jahren in München.


Schloss, Würzburg
Residenz
Einer der bedeutendsten barocken Schlossbauten Europas, ehemalige Residenz der Würzburger Fürstbischöfe, geplant und betreut von Balthasar Neumann.

Museum, Würzburg
Staatsgalerie
Kostbare Beispiele venezianischer Malerei des 16. bis 18. Jahrhunderts. Giovanni Battista Tiepolo. Mythologische Darstellungen.

Museum, Würzburg
Museum am Dom
Liturgische Geräte, Andachtsgrafik, Hinterglasbilder, Objekte der Volksreligiosität, Werke fränkischer Künstler wie Tilman Riemenschneider und Julius Echter, Arbeiten moderner und zeitgenössischer Künstler.

Museum, Würzburg
Museum im Kulturspeicher
Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts von hohem Rang. Regionale Identität und überregionale Entwicklungen. Nachlaß Emy Roeder, private Sammlung „Peter C. Ruppert – Konkrete Kunst in Europa nach 1945“.

Museum, Würzburg
Martin von Wagner Museum
Kunstwerke und Altertümer des Mittelmeerraumes, vorwiegend aus Griechenland, aber auch etruskische und römische, ägyptische und vorderasiatische Kultur. Deutsche, niederländische und italienische Gemälde des 16.-19. Jhs., Skulpturen von Tilman Riemenschneider. Handzeichnungen und Druckgraphik.